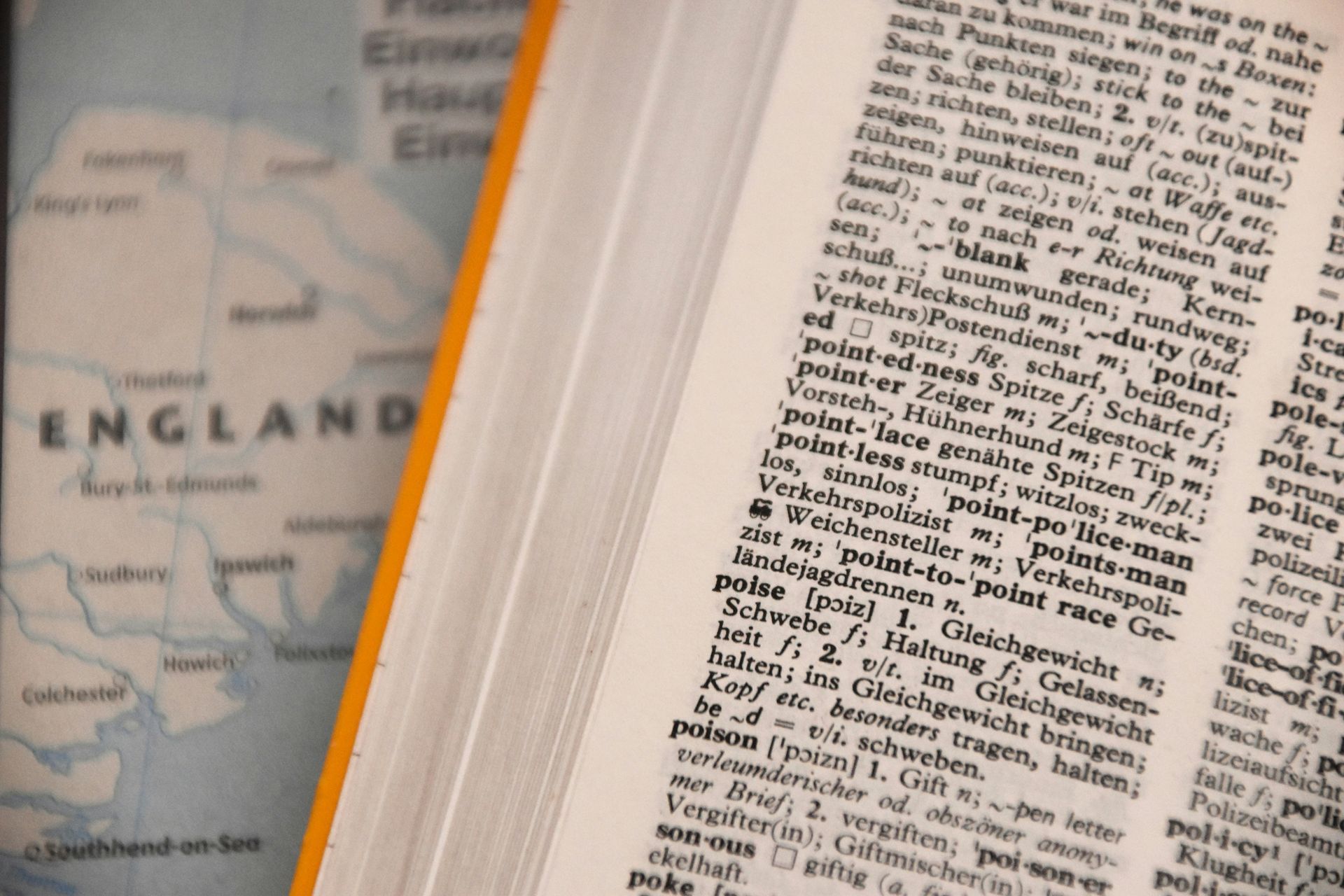Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT)
Der Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT) ist ein Gremium von etwa 25 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Bildungswesen des deutschsprachigen Raums, die sich mit terminologischen Fragestellungen, Anwendungen und mit Ausbildung im Bereich Terminologie beschäftigen. Hauptsächlich initiiert und getragen durch die nationalen UNESCO-Kommissionen von Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, umfasst der RaDT heute auch Vertreter aus Belgien, Dänemark und Italien. In den neuen EU-Mitgliedsländern gibt es Bestrebungen – z.B. in den baltischen Staaten – Terminologiegremien nach dem Modell des RaDT zu gründen. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Neuen Länder hunderttausende Termini bei der Übertragung des EU-Rechtsbestandes in ihre Nationalsprachen neu schaffen müssen und dabei die Erfahrungen von Terminologieexperten im deutschsprachigen Raum nutzen wollen.
Der RaDT diskutiert strategische Fragen zur Position der deutschen Fachsprachen in Europa. Es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass unterentwickelte Fachsprachen mit ihren unterentwickelten oder sogar fehlenden Terminologien negative Auswirklungen auf
- Innovation in Technik und Wirtschaft
- Wissenschaft und Forschung
- Bildungswesen
haben. Umgekehrt ist die „relative Stärke“ des Englischen in den Fachsprachen weltweit auch Ausdruck der wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlich-industriellen Vormachtstellung der angelsächsischen Länder.
Der RaDT hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Produkte und Dienstleistungen im Zeitalter der Globalisierung in den meisten Fällen in den Sprachen der Zielmärkte vermarktet werden müssen. Mit Hinblick auf die Mehrsprachigkeit Europas und seiner wirtschaftlichen Stellung in der Welt spielen mehrsprachige Terminologien in Industrie und Handel bei der Anpassung von Produkten und Übersetzung der technischen Dokumentation eine wesentliche Rolle. Europa könnte hier als Kompetenzregion für die Mehrsprachigkeit der Welt angesehen werden.
Die terminologischen Unterschiede in den Verwaltungs- und Rechtssprachen in deutschsprachigen Ländern waren immer wieder Thema des RaDT. Die österreichischen und Schweizer Mitglieder des RaDT zeigten auf, dass diese Unterschiede aus verschiedenen Gründen nicht nur berechtigt, sondern in der Praxis unverzichtbar sind. Auch die Problematik des „Domänenverlust im Deutschen“ durch exzessive Übernahme von Fremdwörtern wurde angesprochen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen solcher sprachlichen Entlehnungen, wenn sie unreflektiert und exzessiv geschehen, wurden in der Sitzung in einem neuen Positionspapier zum Domänenverlust im Deutschen zusammengefasst. Dabei wird ohne nationalistische Wertung erkannt, dass sich auf bestimmten Fachgebieten das Deutsche als fachsprachliches Kommunikationsmedium durch die Übernahme fremdsprachlicher Elemente zurückentwickelt.
Die Empfehlungen und Dokumente des RaDT hatten wesentlichen Einfluss auf die Formulierung von politischen Programmen, wie z.B. Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, in den Ländern des deutschsprachigen Raumes, auf EU-und internationaler Ebene.
Weitere Pressemeldungen